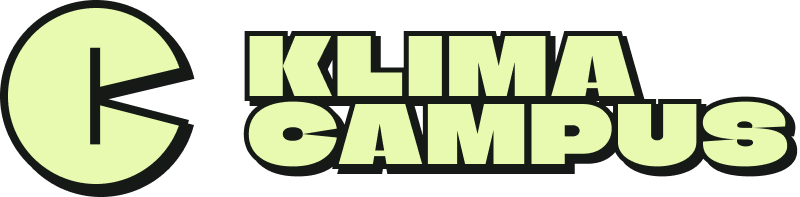Interview: Die Klimafarm
Moore wiedervernässen für Klima- und Artenschutz und Landwirtschaft
Elena ist Projektleiterin der Klimafarm in Schleswig-Holstein – einem von vier bundesweiten Pilotprojekten zum Moorbodenschutz. Im Auftrag der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein koordiniert sie das Projekt. Im Interview erzählt sie, wie die Klimafarm arbeitet, was sie besonders macht und was sie an ihrer Arbeit begeistert.
Was fasziniert dich am Moor?
Elena: Mich fasziniert total die Artenvielfalt und die Landschaftsgestaltung, also wie Moore überhaupt aussehen.
Das ist auch immer mystisch. Hier bei uns in Schleswig-Holstein ist es diese Weite – und dann sind da Kraniche und die Geräuschkulisse. Sobald wir unsere Flächen besuchen und draußen durch unsere Projektgebiete laufen, ist man sofort so im Hier und Jetzt! Es ist für mich ein ganz besonderer, wertvoller Ort.

Was genau steckt hinter der Klimafarm – und woran arbeitet ihr konkret?
Elena: Die Klimafarm ist ein Projekt, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird, von 2021 bis 2031. Das ist etwas ganz Besonderes, dass wir über zehn Jahre gefördert werden. Wir wollen zeigen, dass wir durch die Wiedervernässung von Mooren Treibhausgase einsparen. Als zweites Ziel wollen wir die Flächen landwirtschaftlich bewirtschaften. Das heißt, wir probieren Maschinen aus und testen, welche Maschinen gut funktionieren. Und es gehört eben auch dazu, dass wir den Rohstoff auch verwerten wollen. Das heißt, dass wir den Rohstoff verkaufen, mit Unternehmen kooperieren und Produkte entwickeln.
Was wird eigentlich konkret angebaut bei euch?
Elena: Das Spannende ist, dass wir bei uns im Projekt gar nichts anbauen, sondern dass wir auf Nasswiesen wirtschaften und wir ernten das, was da natürlicherweise wächst und vorkommt.
Wir beeinflussen auch die Ernte nicht, es wird bei uns nichts angesät. Wir nutzen auch keine Düngemittel. Das heißt, am Ende des Tages haben wir einen hundertprozentig natürlichen Rohstoff, den wir anbieten können.

(Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein)
Und was passiert zum Beispiel mit eurem Rohstoff?
Elena: Wir sind in ganz vielen Testphasen unterwegs. Wir haben versucht, Pflanzenkohle zu produzieren. Das hat sehr gut geklappt. Wir haben sogenannte Bodenschutzmatten aus unserem Rohstoff produzieren können, die wir auf dem Wacken-Festival zur Befestigung eines Gehwegs getestet haben. Bodenschutzmatten gab es schon vorher, aber die innovative Idee ist, die Kokosfasern mit Moorfasern auszutauschen. Das hat sehr gut funktioniert.
Die Bilder zeigen, wie die Bodenschutzmatten auf der Teststrecke auf dem Wacken-Festival ausgerollt wird.
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Was wird gemessen und untersucht?
Elena: Wir haben die Uni Kiel mit an Bord. Die Uni Kiel ist zuständig für das Treibhausgas-Monitoring, aber auch für das Biodiversitäts-Monitoring. Bei den Treibhausgasen werden CO₂-Äquivalente gemessen, aber wir haben auch eine Anlage für Methan-Messungen. Gemessen wird auf wiederernässten Flächen und auch auf landwirtschaftlichen Flächen, die konventionell, also trockengelegt bewirtschaftet werden – um einen Vergleich zu haben, ob eine Vernässung wirklich zu CO₂-Einsparung führt, die wir uns erhoffen.
Und das Biodiversitätsmonitoring?
Elena: Das finde ich ganz spannend. Wir wollen nicht nur Klimaschutz in diesem Projekt, sondern eben auch der Biodiversitätskrise entgegenwirken und zeigen, dass man beides verbinden kann. Das ist ja auch der Kern von natürlichem Klimaschutz. Das übergeordnete Ziel ist natürlich, dass wir mit wiedervernässten Flächen auch spezifische Arten zurückholen, die in natürlichen Mooren früher vorgekommen sind.
Gibt es schon erste Zwischenergebnisse?
Es wird jetzt erstmal geguckt, welche Arten schon da sind. Und bis jetzt können wir nur hoffen und mutmaßen, dass Arten zurückkommen. Aber bis sich das eingestellt hat, müssen wir leider schon 10 Jahre warten.
Hast du ein Lieblingstier im Moor?
Elena: Der Kranich.
Was findest du an der Arbeit bei der Klimafarm besonders spannend?
Elena: Also, es ist ein super abwechslungsreicher Job und es erfüllt mich schon sehr, dass ich in einem Bereich arbeite, der richtig, richtig viel bewegen kann. Ich bin ganz vorne im Bereich Klimaschutz. Man vergisst manchmal im Alltag, was wir hier eigentlich für eine herausragende Rolle spielen. Und das ist was ganz Besonderes, dass man eben nicht einfach mit kleinen Pflastern arbeitet, sondern weiß: Wenn wir das hier schaffen, dann haben wir richtig was bewegt.
Gibt es noch etwas, über was du gerne reden möchtest? Etwas, das du wichtig findest?
Elena: Wir vergessen immer wieder, dass wir ein Grundrecht auf Klimaschutz haben. Das ist im Grundgesetz verankert. Wir vergessen auch, dass das eigentlich gar nicht mehr diskutiert werden sollte, sondern es jetzt wirklich darum geht: Wie machen wir das? Wie erreichen wir das? Und was braucht es dafür?! Das finde ich sehr, sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass das nicht einfach irgendwelche Projekte sind, wo irgendeine verrückte Idee dahintersteckt, sondern dass wir hier wirklich für die Gesellschaft etwas bewegen wollen und müssen.
Was erhoffst du dir für die Klimafarm und eure Arbeit?
Elena Ich wünsche mir, dass ganz wunderbare Produkte aus unserem Rohstoff entstehen und dass Landwirte auch anfangen, ihre Flächen zu vernässen und diesen Rohstoff produzieren wollen – weil er eben nicht einfach am Ende getrocknete Pflanzen aus dem Moor ist, sondern auch für Klimaschutz, für Biodiversität steht, für eine Transformation in der Landwirtschaft, für viel Mut und Innovationskraft.
Vielen Dank für das Gespräch, Elena – und für deinen Einsatz für Klima und Artenvielfalt auf der Klimafarm!